| Inhalt: | - Zu Autor und Text vgl. Ulrich Müller, in: VL2 1 (1978), Sp. 672–680 (diese Hs. C); Friederike Niemeyer, Ich, Michel Pehn. Zum Kunst- und Rollenverständnis des meisterlichen Berufsdichters Michel Beheim, Frankfurt/M. (u.a.) 2001 (Mikrokosmos. Beiträge zur Literaturwissenschaft und Bedeutungsforschung 59). Die Überschriften der Lieder in der Regel in Rot, der Text der Str. in Schwarz. Zur Abfolge der Lieder vgl. RSM 1, S. 172. Zählung der Lieder nach Gille/ Spriewald. Initien im Register. – (1. 2ra–32vb) 28 LIEDER IN SEINER ZUGWEISE. „>Hie hebent sich an Michel Pehams geticht von erst seczt er die geticht In seiner zugweis ...<“. Texte (nach dieser Hs.): Gille/ Spriewald 1, S. 3–77 Nr. 1–28, Verzeichnis der Gedichttitel ebd., S. LXXIVf. Zur Parallelüberlieferung vgl. ebd., S. XLVII und das jeweilige RSM-Kapitel. Zum Ton vgl. Schanze 1, S. 206f. Zu den Textquellen der Lieder Nr. 12–21 vgl. Wachinger, Beheim, S. 60f. – 1*r–3*v, 4*r/v (s. Fragmente), 5*r/v, 1r/v leer. – (2. 33ra–43vb) 40 LIEDER IN SEINER KURZEN WEISE. „>Die nach geschriben geticht Sten in Michel Pehams kurczen weis ...<“. Texte (nach dieser Hs.): Gille/Spriewald 1, S. 78–117 Nr. 29–68, Verzeichnis der Gedichttitel ebd., S. LXXV–LXXVII. Zur Parallelüberlieferung vgl. ebd., S. XLVII und das jeweilige RSM-Kapitel. Zu den Textquellen der Lieder Nr. 31–48 vgl. Wachinger, Beheim, S. 65, von Nr. 49 ebd., S. 61. Zum Ton vgl. Schanze 1, S. 207f. – (3. 44ra–129vb) 42 LIEDER IN SEINER OSTERWEISE. „>Dise nach geschriben geticht sten in Michel Pehams Oster weis ...<“. Texte (nach dieser Hs.): Gille/Spriewald 1, S. 118–396 Nr. 69–110, Verzeichnis der Gedichttitel ebd., S. LXXVII–LXXIX. Zur Parallelüberlieferung vgl. ebd., S. XLVII und das jeweilige RSM-Kapitel, Nr. 99–103 nur in dieser Hs. überliefert. Zum Ton vgl. Schanze 1, S. 208–210. Bei Nr. 71–82 handelt es sich um Versifizierungen deutscher Predigten des Nikolaus-von-Dinkelsbühl-Redaktors, bei Nr. 69 und 84 handelt es sich um solche von Gebeten Johanns von Neumarkt und bei Nr. 86 um eine solche eines Gebetes Johanns von Indersdorf. Im Register (455va) Hinweis auf ein weiteres Lied in der Osterweise, das die Hs. selbst nicht hat: „Item uon aidswern Ciiii“ (vgl. RSM 3 1Beh/456). Zu den Textquellen der Lieder Nr. 69, 71–82, 84, 86–87, 96, 108–110 vgl. Wachinger, Beheim, S. 61f. Zum Text von Nr. 87 vgl. Burghart Wachinger, ‘Goldenes Ave Maria’, in: VL2 3 (1981), Sp. 79–84, bes. Sp. 81 Nr. I.1.a. – 129a*r/v leer. – (4. 130ra–234va) 100 LIEDER IN SEINER VERKEHRTEN WEISE. „>Die hernach geschriben geticht Sten in Michel Pehams verkerten weis ...<“. Texte (nach dieser Hs.): Gille/ Spriewald 2, S. 3–379, Nr. 148–201, 203–249, Verzeichnis der Gedichttitel ebd., S. VII–XI. Zur Parallelüberlieferung vgl. Gille/Spriewald 1, S. XLVIII und das jeweilige RSM-Kapitel. Zum Ton vgl. Schanze 1, S. 210–212. Zu den Textquellen der Lieder Nr. 151–162 vgl. Wachinger, Beheim, S. 63. Bei den Liedern Nr. 235–236 handelt es sich um Versifizierungen nach Texten aus dem Ketzerteil (Kap. 43–44) des lat. Sammelwerks des Passauer Anonymus (Anonymus Pataviensis); vgl. Ernst-Dietrich Güting, Michel Beheims Gedicht gegen den Aberglauben und seine lat. Vorlage. Zur Tradierung des Volksglaubens im Spätmittelalter, in: Forschungen und Berichte zur Volkskunde in Baden-Württemberg 1974–1977, hrsg. von Irmgard Hampp/Peter Assion, Stuttgart 1977 (Forschungen und Berichte zur Volkskunde in Baden-Württemberg 3), S. 197–220, bes. S. 212–218. Beheim hat diesen Text sehr wahrscheinlich in Form einer dt. Prosaübertragung rezipiert, die neuerdings dem Österreichischen Bibelübersetzer zugeschrieben wird; vgl. Manuela Niesner, Die ‘Contra-Judæos-Lieder’ des Michel Beheim. Zur Rezeption Irmhart Ösers und des Österreichischen Bibelübersetzers im 15. Jahrhundert, in: PBB 126 (2004), S. 398–424, bes. S. 399f. Der Zyklus von Liedern in der Verkehrten Weise wird in der Hs. sowie in der restlichen Überlieferung in mehrere Bücher unterteilt: (154va–191vb) Büchlein von den sieben Todsünden (Lieder Nr. 164–201; Zyklus von eigentlich 39, hier jedoch nur 38 Liedern). Bei den meisten der Lieder handelt es sich um eine Versifizierung des zweiten Teils der ‘Erchantnuzz der sund’ des Heinrich von Langenstein; vgl. Thomas Hohmann, Deutsche Texte aus der ‘Wiener Schule’ als Quelle für Michael Beheims religiöse Gedichte, in: ZfdA 107 (1978), S. 319–323, bes. S. 320–323; Wachinger, Beheim, S. 63; William C. McDonald, ‘Whose bread I eat’: the song-poetry of Michel Beheim, Göppingen 1981 (GAG 318), bes. S. 166–178. Zu Heinrich von Langenstein (Henricus de Langenstein) vgl. Thomas Hohmann/Georg Kreuzer, in: VL2 3 (1981), Sp. 763–773, bes. Sp. 768–770. – (191vb–210va) Büchlein von den Juden (Lieder Nr. 203–226; Zyklus von 24 Liedern). Bei den Liedern des Zyklus handelt es sich eine Versifizierung der ‘Epistel des Rabbi Samuel an Rabbi Isaac’ des Irmhart Öser; vgl. Wachinger, Beheim, S. 63. Zu Irmhart Öser vgl. Karl Heinz Keller, in: VL2 7 (1989), Sp. 84–89, bes. Sp. 85–88. – (210va–219rb) ‘Contra-Iudæos’-Lieder (Lieder Nr. 227–234; Zyklus von 8 Liedern). „>Die ticht sagen vom talmut ...<“. Bei den Liedern des Zyklus handelt es sich um eine Versifizierung des früher Heinrich von Mügeln zugeschriebenen Traktats ‘Von der juden jrrsall’ des Österreichischen Bibelübersetzers. Dieser Traktat geht wiederum auf den Judenteil des lat. Sammelwerks des Passauer Anonymus (Anonymus Pataviensis) zurück; vgl. Wachinger, Beheim, S. 63; McDonald, s.o., S. 104 Anm. 49. Zum Passauer Anonymus vgl. Alexander Patschovsky, in: VL2 7 (1989), Sp. 320–324; zum Österreichischen Bibelübersetzer vgl. Gisela Kornrumpf, in: VL2 11 (2004), Sp. 1.097–1.110, bes. Sp. 1.107; zum Traktat vgl. Manuela Niesner, ‘Wer mit juden well disputiren’. Deutschsprachige Adversus-Judæos-Literatur des 14. Jahrhunderts, Tübingen 2005 (MTU 128), S. 54–118; dies., in: VL2 11 (2004), Sp. 812–815. Zur Versifizierung der Lieder durch Beheim vgl. Niesner, ‘Contra-Judæos-Lieder’, s.o. 130ra. – 228va–228vb, 234vb leer. – (5. 235ra–259vb) 32 LIEDER IN SEINER TRUMMETENWEISE. „>Dise hernach geschriben getih [!] sten in Michel Pehams trummeten weis ...<“. Texte (nach dieser Hs.): Gille/ Spriewald 2, S. 380–449 Nr. 250–281, Verzeichnis der Gedichttitel ebd., S. XIf. Zur Parallelüberlieferung vgl. Gille/Spriewald 1, S. XLVIII und das jeweilige RSM-Kapitel. Zum Ton vgl. Schanze 1, S. 212f. Zu den Textquellen der Lieder Nr. 251–260 vgl. Wachinger, Beheim, S. 66, zu der von Nr. 263 ebd., S. 64. Zum Text von Lied Nr. 250 vgl. Christoph Petzsch, Muskatblüt Nr. 62 und Michel Beheim Nr. 250. Zum uneigentlichen Sprechen im Spätmittelalter, in: Euphorion 76 (1982), S. 275–294. – (6. 260ra–272vb) 5 LIEDER IN SEINER GEKRÖNTEN WEISE. „>Dise her nach geschriben getich [!] sten in Mich [!] iben geticht sten [durchgestrichen: iben geticht sten]Pehams gekronten weis ...<“. Texte (nach dieser Hs.): Gille/Spriewald 2, S. 451–481 Nr. 283–287, Verzeichnis der Gedichttitel ebd., S. XII. Zur Parallelüberlieferung vgl. Gille/Spriewald 1, S. XLVIII und das jeweilige RSM-Kapitel. Zum Ton vgl. Schanze 1, S. 213. Zu der Textquelle des Liedes Nr. 285 vgl. Wachinger, Beheim, S. 64, zu der von Nr. 286 Adelbert von Keller, Gesta Romanorum, Quedlinburg (u.a.) 1841 (BiblNLit. 23), S. 129. – (7. 273ra–285rb) 9 LIEDER IN SEINER SLEHT GULDIN WEISE. „>Dise nach geschriben geticht sten in Michel Behams slecht güldin weis oder don ...<“. Texte (nach dieser Hs.): Gille/Spriewald 2, S. 482–547 Nr. 288–296, Verzeichnis der Gedichttitel ebd., S. XIIf. Zur Parallelüberlieferung vgl. Gille/Spriewald 1, S. XLVIII und das jeweilige RSM-Kapitel. Zum Ton vgl. Schanze 1, S. 214; Christoph Petzsch, Michel Beheims reimreiche ‘sleht gülden weise’, in: Musikforschung 20 (1967), S. 44–55. Zu der Textquelle der Lieder Nr. 291 vgl. Wachinger, Beheim, S. 66, Nr. 293 ebd., S. 64 und Nr. 294 Keller, s.o. 260ra, S. 144f. – (8. 285rb–287vb) 2 LIEDER IN SEINER HOHEN GULDIN WEISE. „>Dise her nach geschriben geticht die sten in Michel Pehams hach guldin weis vnd all silben haben ir reinen [!] es ist kainer ledig sie gen uber haf uer porgen und auch offen ...<“. Texte (nach dieser Hs.): Gille/Spriewald 2, S. 552–556 Nr. 298–299, Verzeichnis der Gedichttitel ebd., S. XIII. Zur Parallelüberlieferung vgl. Gille/Spriewald 1, S. XLVIII und das jeweilige RSM-Kapitel. Zum Ton vgl. Schanze 1, S. 214. Zu der Textquelle des Liedes Nr. 299 vgl. Wachinger, Beheim, S. 64. – 285va–285vb leer. – (9. 287vb–357va) 56 LIEDER IN SEINER HOFWEISE. „>Dise nach geschriben getich sten in Michel Pehams hof weis ...<“. Texte (nach dieser Hs.): Gille/Spriewald 2, S. 557–787 Nr. 300–355, Verzeichnis der Gedichttitel ebd., S. XIII–XVI. Zur Parallelüberlieferung vgl. Gille/Spriewald 1, S. XLVIIIf. und das jeweilige RSM-Kapitel, Nr. 329, 344–346 nur in dieser Hs. überliefert. Zum Ton vgl. Schanze 1, S. 214–216. Zu den Textquellen der Lieder Nr. 303 und 308 vgl. Wachinger, Beheim, S. 64, von Nr. 305 ebd., S. 66, von Nr. 309 ebd., S. 55f. und von Nr. 320 Klaus ...
|



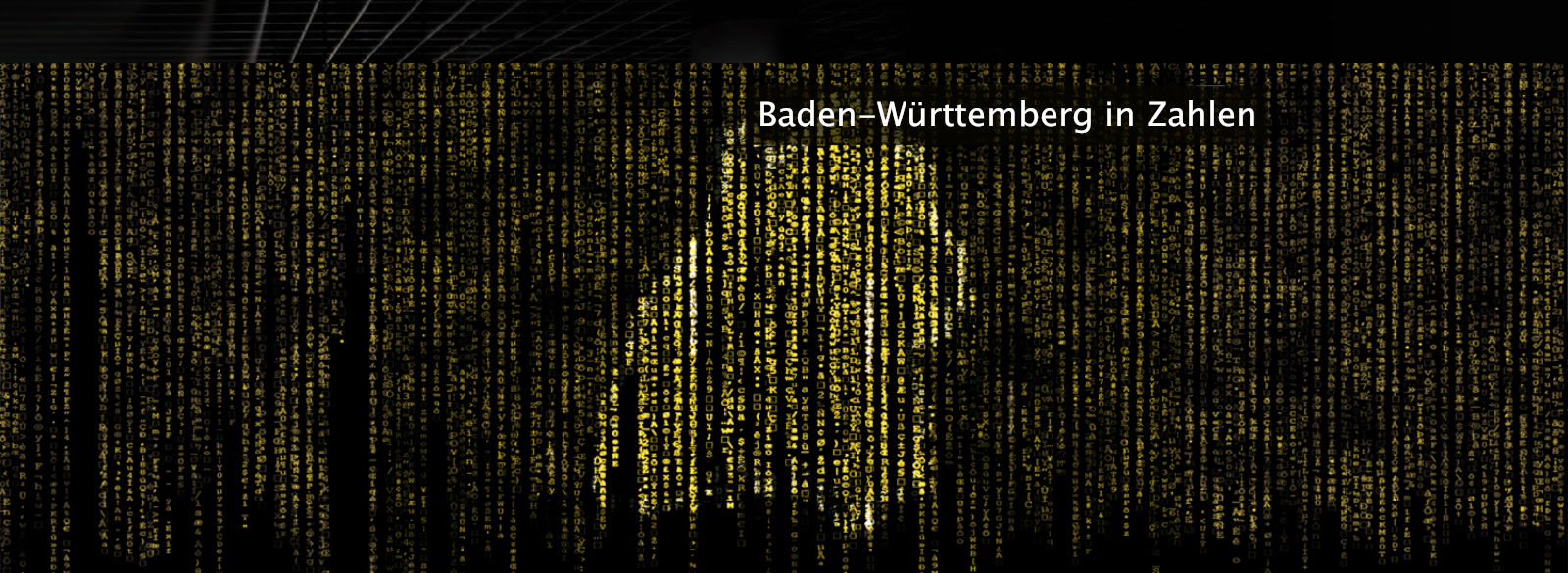



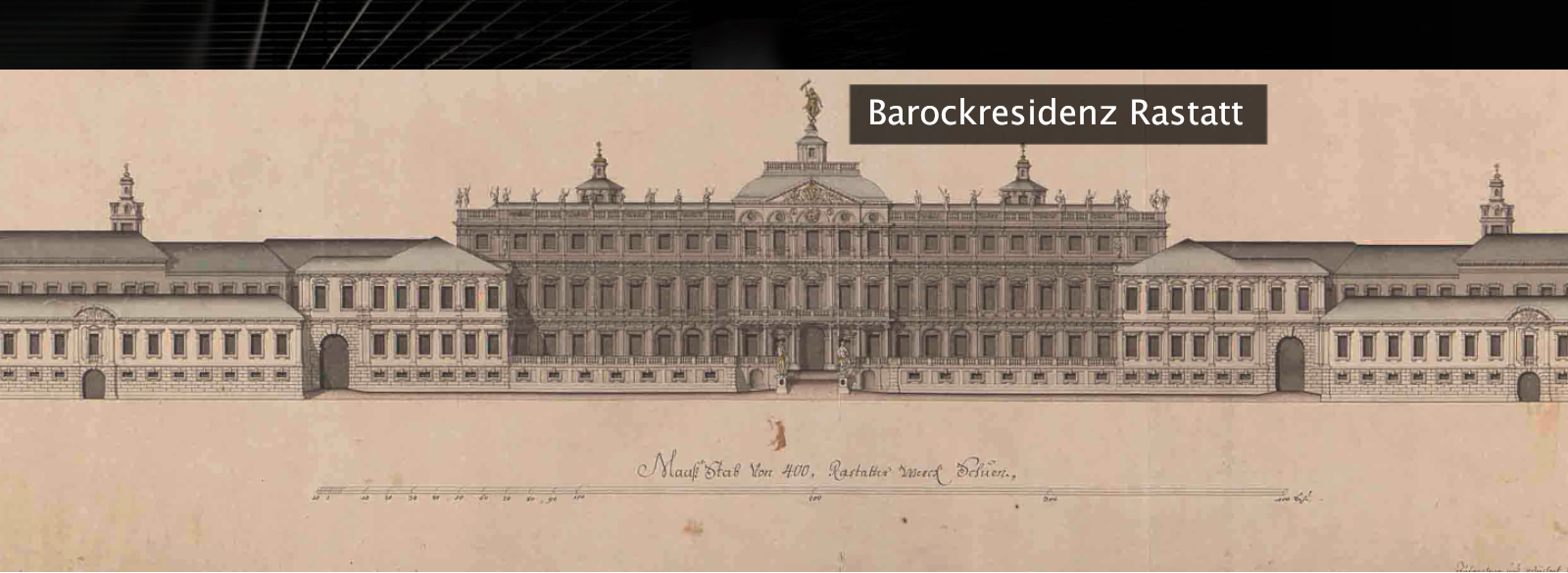
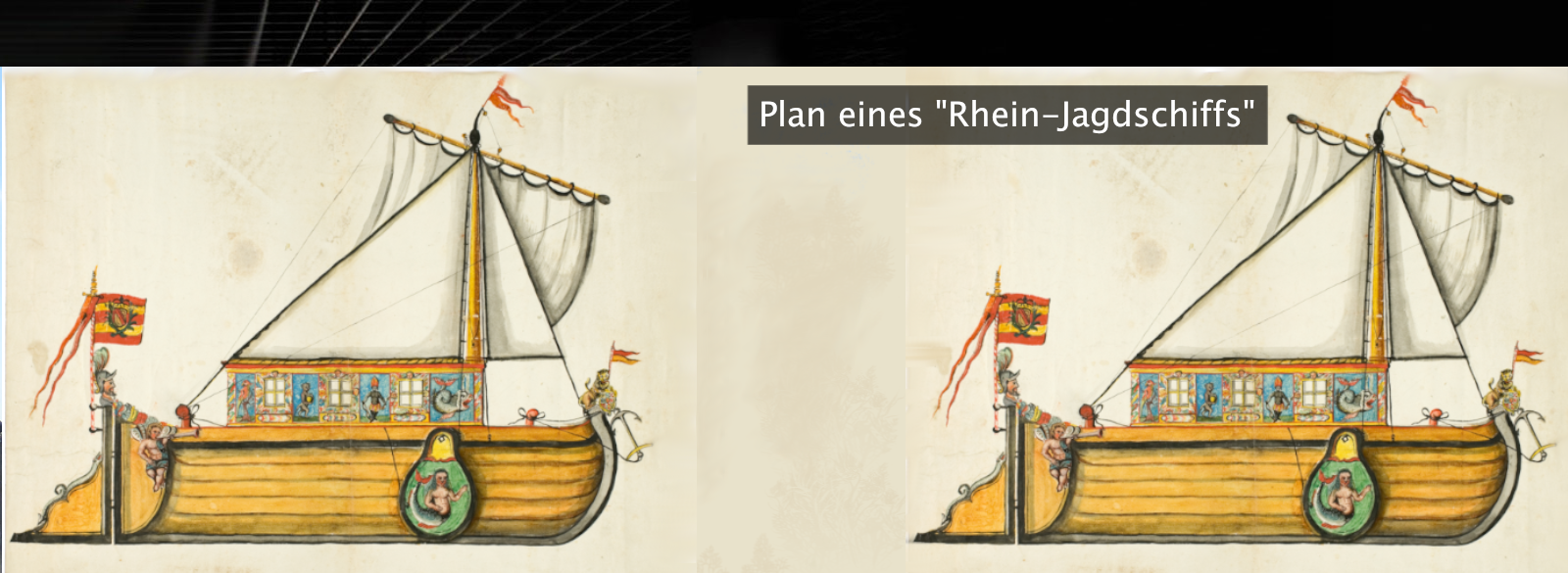


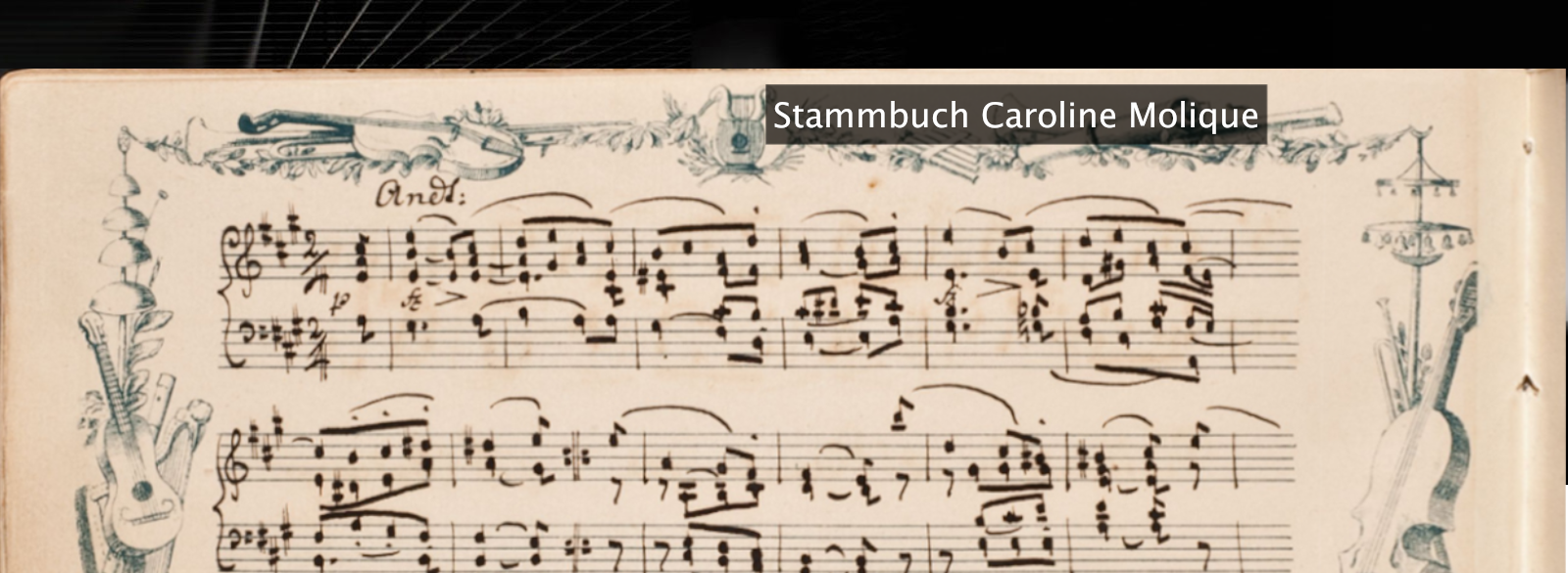
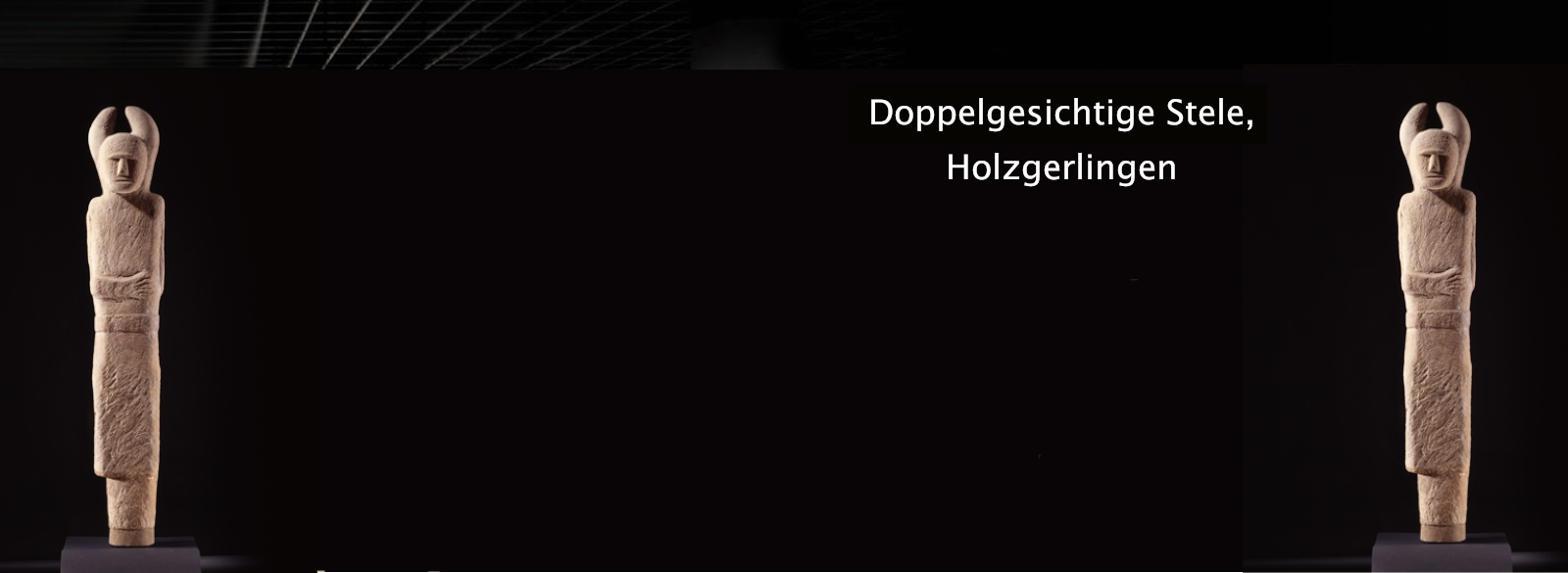

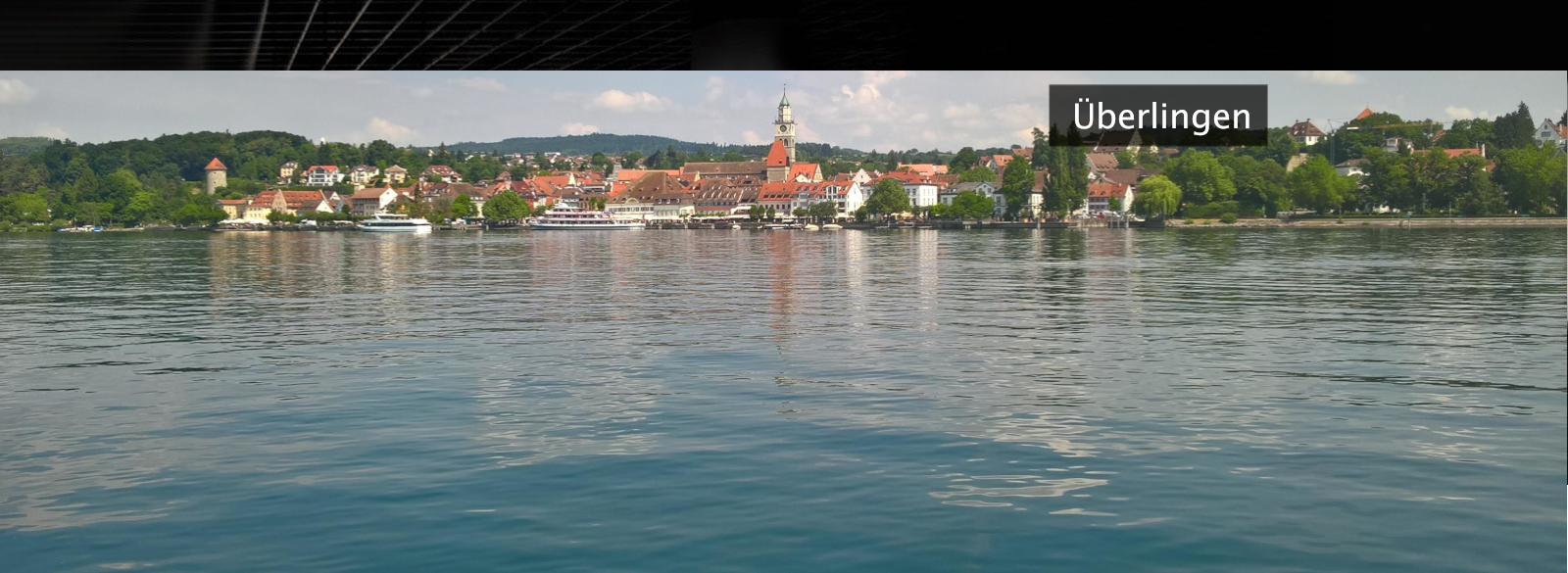

 leobw
leobw