Wolf, Erik Franz
| Geburtsdatum/-ort: | 13.05.1902; (Wiesbaden-)Biebrich |
|---|---|
| Sterbedatum/-ort: | 15.10.1977; Freiburg im Br., beigesetzt in Vogtsburg-Oberrotweil |
| Beruf/Funktion: |
|
| Kurzbiografie: | 1920 Abitur in Frankfurt am M. 1920–1924 Studium d. Nationalökonomie (1 Sem.) u. d. Rechtswissenschaft in Frankfurt am M. u. Jena 1924 II. 28 Abschluss mit Promotion zum Dr. iur. bei Franz Wilhelm Jerusalem: „Die Entwicklung des Rechtsbegriffs im reinen Naturrecht“ 1924–1925 Studium d. Philosophie in Heidelberg. Privatassistent von Prof. Alexander Graf zu Dohna 1925–1927 Assistent an d. jurist. Fakultät in Heidelberg 1927 IV. 30 Habilitation für Strafrecht u. Rechtsphilosophie in Heidelberg: „Strafrechtliche Schuldlehre“ 1927–1928 Lehrstuhlvertreter in Kiel (3 Semester) 1928 X. 1 Ordinarius für Strafrecht an d. Univ. Rostock 1930 ab Anfang April Ordinarius für Strafrecht an d. Universität Kiel, ab Anfang Oktober Ordinarius für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie, allgemeine Rechtslehre u. Gefängniskunde an d. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Br., Direktor des Seminars für Strafvollzugskunde; 1933 Lehrauftrag für Kirchenrecht; ab 15. Okt. Dekan d. Rechts- u. Staatswiss. Fakultät, von Rektor Martin Heidegger ernannt. 1934 IV. 23 Rücktritt von diesem Amt (wie auch Rücktritt Heideggers vom Amt des Rektors) 1937 Mitglied d. NSDAP 1938–1945 Hilfsrichter am Landgericht Freiburg (Strafkammer) 1945 XII. Neuumschreibung d. Lehraufgaben: Rechts- u. Staatsphilosophie, Geschichte d. Rechtswissenschaft u. Kirchenrecht. Gründung des Seminars für Rechtsphilosophie u. ev. Kirchenrecht. 1967 IX. 30 Entpflichtung |
| Weitere Angaben zur Person: | Religion: ev. (ref.) Auszeichnungen: Ehrungen: D. theol. h. c. der Universität Heidelberg (1948); Dr. iur. h. c. der Universität Athen (1972); Dr. phil. h. c. der Universität Tübingen (1977). – Taxiarchenkreuz des griech. Phoenix-Ordens (1959); Sigmund-Freud-Preis für wiss. Prosa der Dt. Akademie für Sprache und Dichtung (1972) Verheiratet: 1944 (Freiburg im Br.) Olga, geb. Never (1908–1993) Eltern: Vater: Franz (1869–1943), Dr. phil., Chemiker Mutter: Gertrud, geb. Burckhardt (1870–1931) Geschwister: Johann Peter (1896–1974), Gymnasiallehrer für Biologie in Basel Kinder: keine |
| GND-ID: | GND/118769839 |
Biografie
| Biografie: | Alexander Hollerbach (Autor) Aus: Baden-Württembergische Biographien 5 (2013), 481-483 Wolf stammte aus einer sozusagen doppelten Mischehe: Sein Vater war Deutscher, seine Mutter Schweizerin aus dem Basler Patriziergeschlecht der Burckhardt (ckdt); der Vater war katholisch, die Mutter reformiert. Nach der frühen Trennung der Eltern verstärkte sich die Beziehung zur Schweiz; so war (und blieb) das Alemannische Wolfs eigentliche Muttersprache. Hochbegabt und hochsensibel, aber auch gesundheitlich labil, suchte Wolf im geistig-kulturellen Leben der Zeit nach dem I. Weltkrieg seinen Weg zu finden und setzte sich dabei vielfältigen Einflüssen aus: Graf Keyserling, Rudolf Steiner, Stefan George, Friedrich Gundolf. Groß war sein Interesse für die literarische Moderne. Mit der Entscheidung für das Studium der Jurisprudenz erstrebte er bewusst Bodenhaftung und die Befähigung zum Wirken für die soziale Gemeinschaft. Demgegenüber war (und blieb) ihm (partei-) politisches Engagement fremd. Auf der Suche nach philosophischer Orientierung wurden ihm Begegnungen mit Eberhard Grisebach, Gerhart Husserl und Martin Heidegger wichtig. Nach seiner von Gustav Radbruch betreuten Heidelberger Habilitation – seine „Schuldlehre“ war noch weitgehend der philosophischen Konzeption des Neukantianismus verpflichtet – hat Wolf rasch Karriere gemacht. Als er 1928 nach Rostock berufen wurde, war er mit 26 Jahren der jüngste deutsche Ordinarius. In Freiburg geriet er dann in den Bannkreis von Martin Heidegger, dem er großes Vertrauen entgegenbrachte, der ihn umgekehrt als unabhängigen Wissenschaftler hoch schätzte. Im Oktober 1933 ernannte ihn Rektor Heidegger zum Dekan der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät. Seine Amtsführung, bei der er universitätsreformerische Ideen verfocht, führte allerdings zu erheblichen Misshelligkeiten und löste Widerstand aus – ein wesentliches Moment in dem Geflecht von Ursachen für den von Wolf und Heidegger im April 1934 vollzogenen Rücktritt von ihren Ämtern. Seitdem hat sich Wolf ganz aus der Universitätspolitik zurückgezogen. Wissenschaftlich befruchtete er zunächst die strafrechtsdogmatische und kriminalpolitische Diskussion, sich mehr und mehr am Leitbild eines „autoritär-sozialen“ Strafrechts orientierend. Zugleich förderte er die Pflege der Gefängniskunde. Er trat aber auch mit Schriften hervor, die nicht nur in einem allgemeinen Sinne dem Zeitgeist Tribut zollten, sondern die konkret versuchten, den Nationalsozialismus zu legitimieren und ihm ein rechtsphilosophisches Fundament zu geben. In ähnlicher Weise war ihm anfänglich daran gelegen, evangelisches Christentum und Nationalsozialismus in ein positives Beziehungsverhältnis zu bringen. Die entsprechenden Schriften sind aber Episode geblieben. Wolf hat diese Linie nicht weiterverfolgt oder gar systematisch ausgebaut, sondern sich zunehmend davon abgekehrt. Den 1937 vollzogenen Eintritt in die NSDAP, der schon nicht mehr ins Bild passte, hat er als Formsache betrachtet, sich im Übrigen jeglicher Aktivität für die Partei enthalten. Für die zunehmende Distanzierung von den ideologischen Zeitströmungen spielten seine Verwurzelung in der evangelischen Kirche – er war 1931/32 Mitglied von Freiburger Kirchengremien und 1933/34 der badischen Landessynode – und sein früh einsetzendes praktisches und schriftstellerisches Engagement für die „Bekennende Kirche“ eine maßgebende Rolle. 1934 wurde er Mitglied des Freiburger Ortsbruderrats und der Bekenntnisgemeinschaft in Baden. Das führte u.a. zu Kontakten mit Martin Nimöller und später zur Mitarbeit im Freiburger Bonhoeffer-Kreis. Zu dessen Denkschrift „Politische Gemeinschaftsordnung. Ein Versuch zur Selbstbesinnung des christlichen Gewissens in den politischen Nöten unserer Zeit“ hat er zusammen mit Franz Böhm den Abschnitt „Rechtsordnung“ beigesteuert. Im Umkreis der Ereignisse des 20. Juli 1944 geriet er in den Verdacht der Beihilfe zum Hochverrat und wurde einem scharfen Verhör unterzogen. Man wunderte sich damals, dass nicht auch er verhaftet wurde, wie das Gerhard Ritter, Constantin von Dietze und Adolf Lampe widerfahren ist. Blickt man auf die literarische Produktion Wolfs in der 2. Hälfte der 1930er-Jahre, so entfremdete er sich dem Strafrecht mehr und mehr. Umso stärker konzentrierte er sich als „geistesgeschichtlich arbeitender Rechtsphilosoph“, so eine Selbstcharakterisierung, auf die Erarbeitung des Werks „Große Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte“, das, 1939 erstmals erschienen, zu einem Bestseller wurde – es zeigte damals das andere Deutschland. Außerdem kamen eindringliche philosophisch orientierte Studien zum Rechtsgedanken in der deutschen Dichtung zustande. Nach 1945 leistete Wolf in vorderster Front einen großen, kräftezehrenden Einsatz für den kirchlichen „Wiederaufbau“ in der evangelischen Landeskirche Badens und bei der Schaffung der Evangelischen Kirche in Deutschland, deren Grundordnung vom 13. Juli 1948 er als Mitglied des Verfassungsausschusses gemeinsam mit Heinz Brunotte und Hermann Ehlers erarbeitet hat. Hinzu kamen ökumenische Aktivitäten in Bossey bei Genf, bis hin zur Teilnahme an der Gründungsversammlung des Ökumenischen Rates in Amsterdam. 1949 trat Wolf allerdings von allen kirchlichen Ämtern zurück, eine Entscheidung, die durch Meinungsverschiedenheiten über die liturgische Grundausrichtung in der unierten badischen Landeskirche ausgelöst war. Er sprach von „kalter Lutheranisierung“, die ihn als Reformierten, der er von Hause aus war, besonders belastete. Davon blieben aber seine wissenschaftlichen Bemühungen um die Ausarbeitung einer theologischen Grundlegung des Kirchenrechts und einer spezifischen Rechtstheologie unberührt, wovon schon „Rechtsgedanke und biblische Weisung“ (1948) Zeugnis gab, später dann „Recht des Nächsten“ (1958) und schließlich „Ordnung der Kirche. Lehr- und Handbuch des Kirchenrechts auf ökumenischer Basis“ (1961). Begriffe wie „biblische Weisung“, „bekennendes Kirchenrecht“ und „christokratische Bruderschaft“ bzw. „bruderschaftliche Christokratie“ zeigen wesentliche Elemente seiner spezifisch rechtstheologischen, durch Beziehungen zu Karl Barth befruchteten Bemühungen im Kampf gegen Positivismus und Formalismus im Kirchenrecht an. Sein Versuch, Recht überhaupt auf das Verhältnis zum Nächsten als Schlüsselkategorie zu gründen, hat kaum Echo gefunden. Er zeichnet sich aber durch eine bemerkenswerte Offenheit für die ökologische Dimension der menschlichen Existenz in dieser Welt aus und vermittelt starke rechtsethische Impulse. Ein anderer Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit hat in dem sechsbändigen Werk „Griechisches Rechtsdenken“ Niederschlag gefunden, das, vielfach Anregungen aus der Philosophie Heideggers folgend, von den Vorsokratikern bis Platon reicht und sich insbesondere durch seine Rechtswortanalysen auszeichnet. In die für die unmittelbare Nachkriegszeit kennzeichnende Debatte um das Naturrecht hat Wolf mit seinem in drei Auflagen erschienenen Buch „Das Problem der Naturrechtslehre“ eingegriffen. Mit der Ausarbeitung der These von der Abhängigkeit von Naturrecht sowohl vom Natur- wie vom Rechtsbegriff, die sich in einer Vielfalt von Naturrechtskonzeptionen zeigt, andererseits mit der Betonung der Eindeutigkeit der Funktion, nämlich legitimierender Grund und normierendes Richtmaß zu sein, hat er Orientierung zu geben versucht, für seine eigene Position allerdings auf seine Rechtstheologie verwiesen. Eine bemerkenswerte Facette der geistig ungemein reichen Persönlichkeit Wolfs bildet seine Vertrautheit mit der Welt der Schnecken und Käfer. Von ihm angelegte wertvolle Sammlungen werden im Freiburger Naturkundemuseum und im Zoologischen Institut der Universität verwahrt. Außerdem stammen etliche aufschlussreiche Fundberichte „zur Coleopterenfauna der Freiburger Bucht und des Kaiserstuhls“ von ihm. In Vogtsburg-Oberrotweil, wo Wolf seit 1959 wohnte, erinnern der „Professor-Erik-Wolf-Weg“ und die „Erik-Wolf-Stube“ im sogenannten Schlössle (beim Rathaus) an ihn. |
|---|---|
| Quellen: | Nachlass im UA Freiburg. |
| Werke: | Bibliographie in: Existenz u. Ordnung. Fs. für Erik Wolf zum 60. Geburtstag, hg. v. Thomas Würtenberger u.a., 1962, 491-504, Ergänzungen in: Erik Wolf, Rechtsphilosoph. Studien, hg. v. A. Hollerbach, 1972, 317-321; Erik Wolf, Studien zur Geschichte des Rechtsdenkens, hg. v. A. Hollerbach, 1982, 221-228. – (Auswahl): Grotius, Pufendorf, Thomasius, 1927; Strafrechtl. Schuldlehre, 1928; Richtiges Recht im nationalsozialistischen Staate, 1934; Große Rechtsdenker d. dt. Geistesgeschichte, 1939, 2. Aufl. 1944, 3. Aufl. 1951, 4. Aufl. 1963; Vom Wesen des Rechts in dt. Dichtung, 1946; Rechtsgedanke u. biblische Weisung, 1948; Griechisches Rechtsdenken, 6 Bde., 1950–1970; Fragwürdigkeit u. Notwendigkeit d. Rechtswissenschaft, 1953; Das Problem d. Naturrechtslehre, 1955, 2. Aufl. 1959, 3. Aufl. 1964; Recht des Nächsten, 1958, 2. Aufl. 1966; Ordnung d. Kirche, 1961; Rechtsphilosoph. Studien, 1972 (s.o.); Rechtstheolog. Studien, hg. v. A. Hollerbach, 1972; Studien zur Geschichte des Rechtsdenkens, 1982 (s.o.). |
| Nachweis: | Bildnachweise: UA Freiburg D 13/118 u. 1505, zwei Fotos. |
Literatur + Links
| Literatur: | Thomas Würtenberger u.a. (Hgg.) Existenz u. Ordnung, FS für Erik Wolf zum 60. Geburtstag, 1962; W. Steinmüller, Ev. Rechtstheologie, 1968, 257-453; W. Heinemann, Die Relevanz d. Philosophie Martin Heideggers für das Rechtsdenken, 1970; Mensch u. Recht, FS zum 70. Geburtstag von Erik Wolf, hg. v. A. Hollerbach u.a., 1972; A. Hollerbach, Zu Leben u. Werk Erik Wolfs, in: Studien zur Gesch. des Rechtsdenkens, 1982, 235-271 (auch in: A. Hollerbach, Ausgewählte Schriften, hg. v. G. Robbers, 2006, 487-516); R. Mehring, Rechtsidealismus zwischen Gemeinschaftspathos u. kirchl. Ordnung, in: Zs. für Religions- u. Geistesgesch. 44, 1992, 140-156; G. Bauer-Tornack, Sozialgestalt u. Recht d. Kirche. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Karl Barth u. Erik Wolf, 1996; A. Hollerbach, Jurisprudenz in Freiburg, 2007, darin mehrere Beiträge, 193-232, 331-372; ders., Erik Wolf. Wirken für Kirche u. Recht, in: Jahrb. für bad. Kirchen- u. Religionsgeschichte II, 2008, 47-67; ders., Zum Verhältnis von Erik Wolf u. Martin Heidegger, in: Heidegger-Jahrb. 4, 2009, 284-347; ders., Erik Wolf u. das Staatskirchenrecht, in: Thomas Holzner/Hannes Ludyga (Hgg.), Entwicklungstendenzen des Staatskirchen- u. Religionsverfassungsrechts, 2013, 539-550. |
|---|



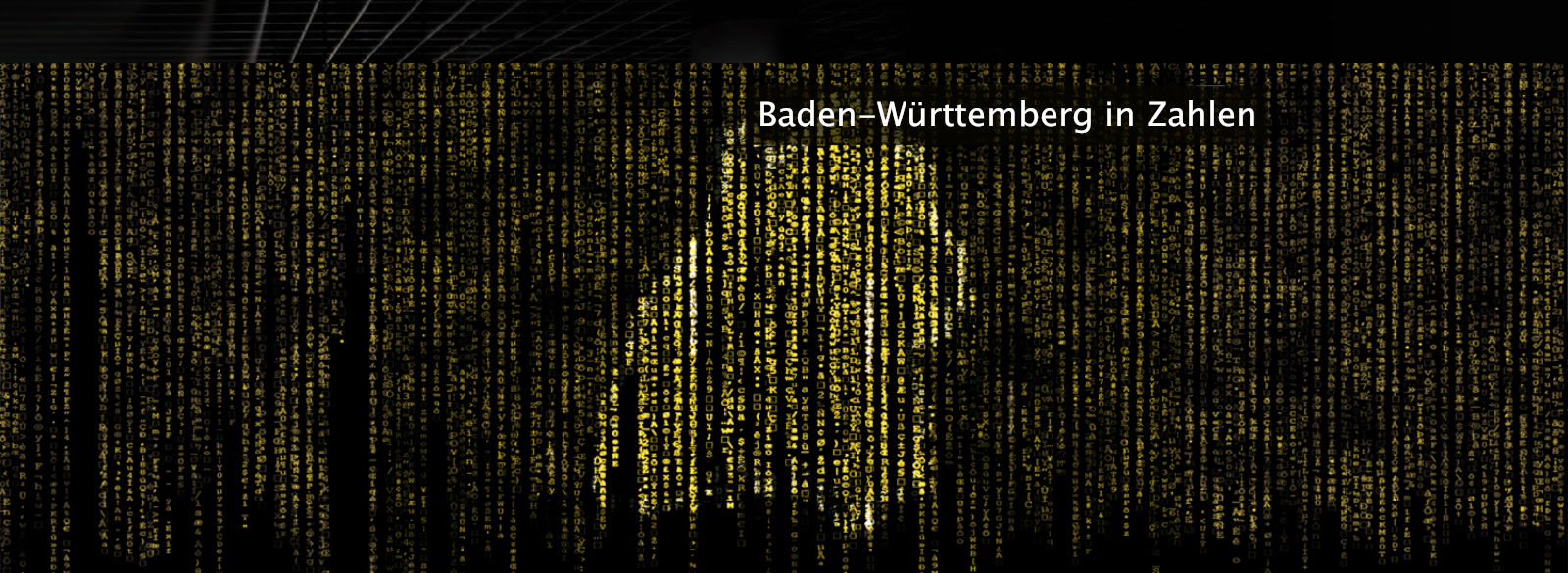



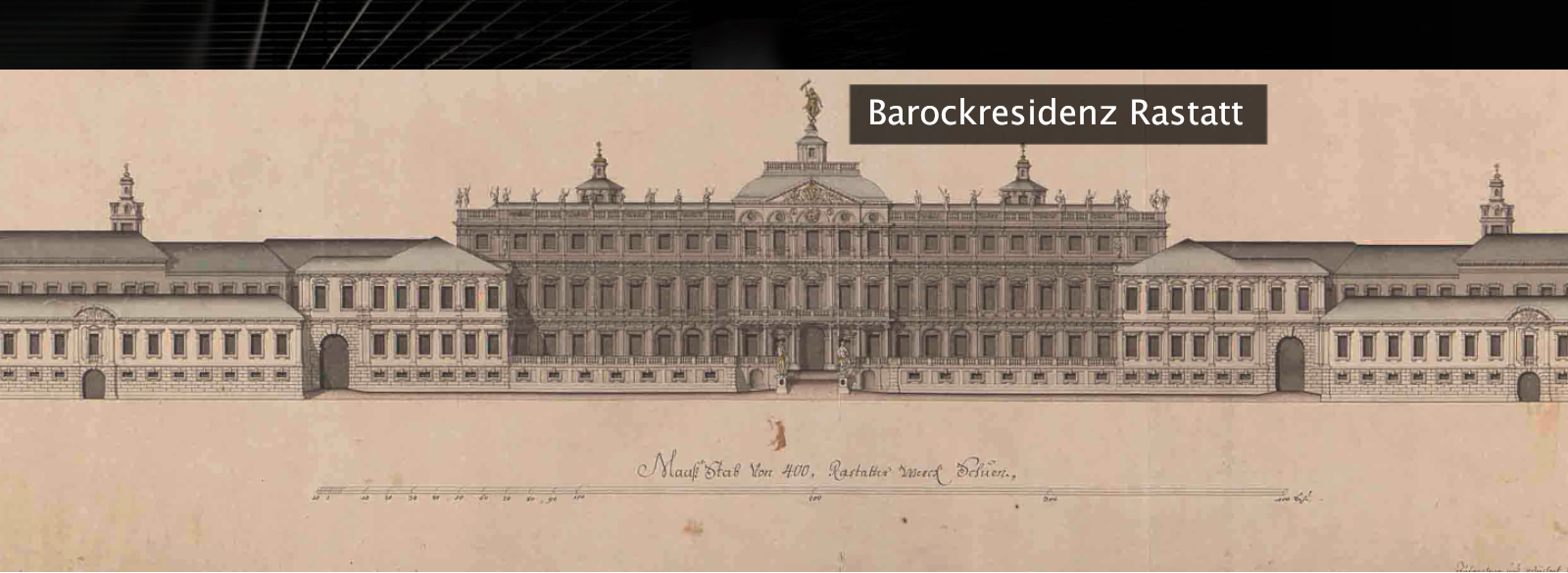
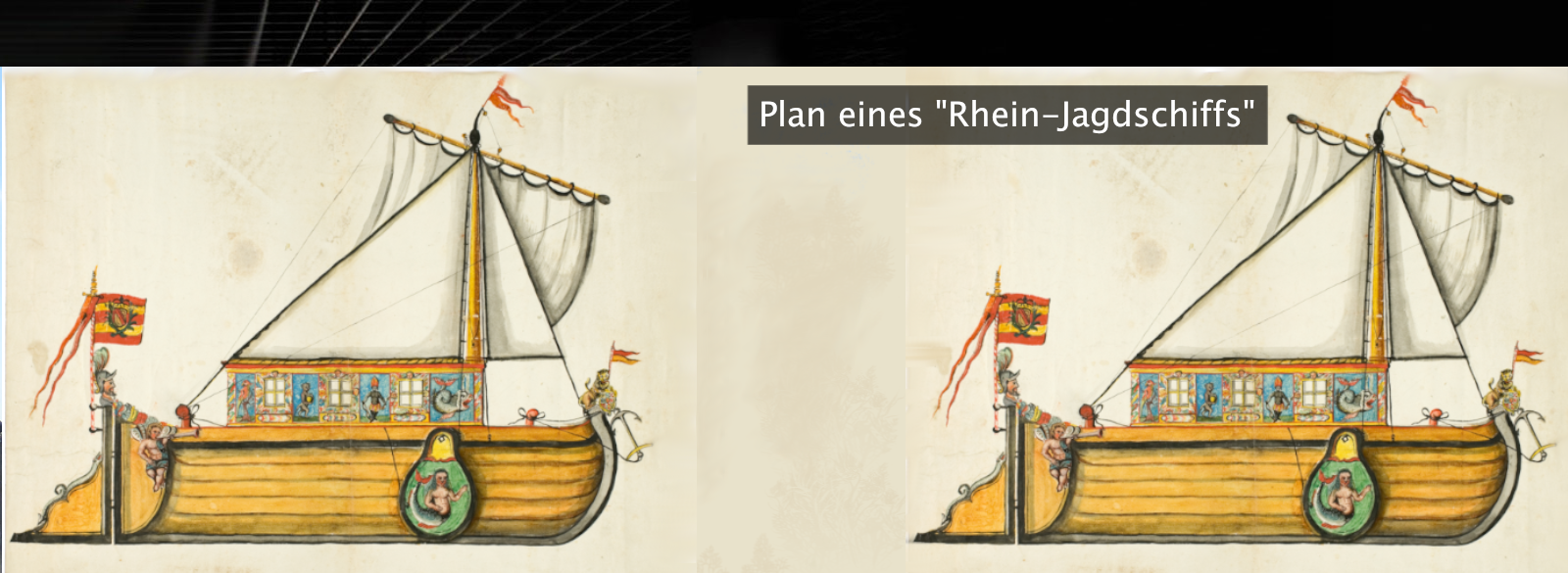


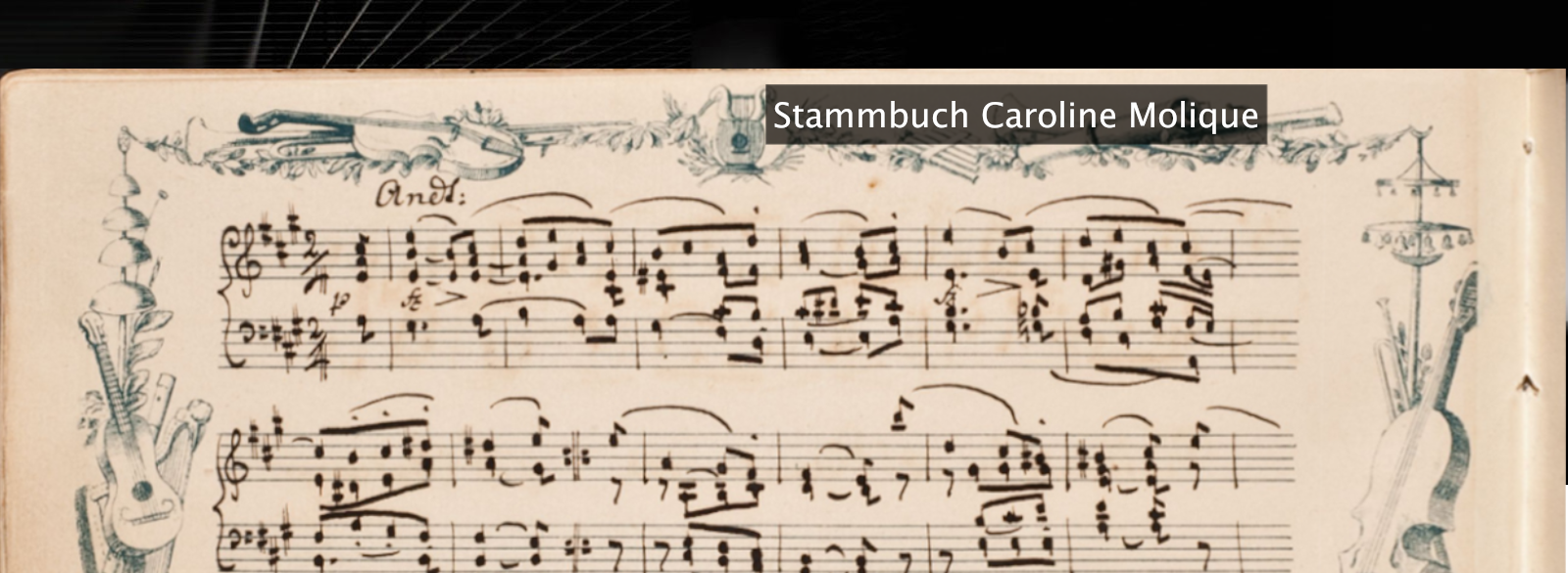
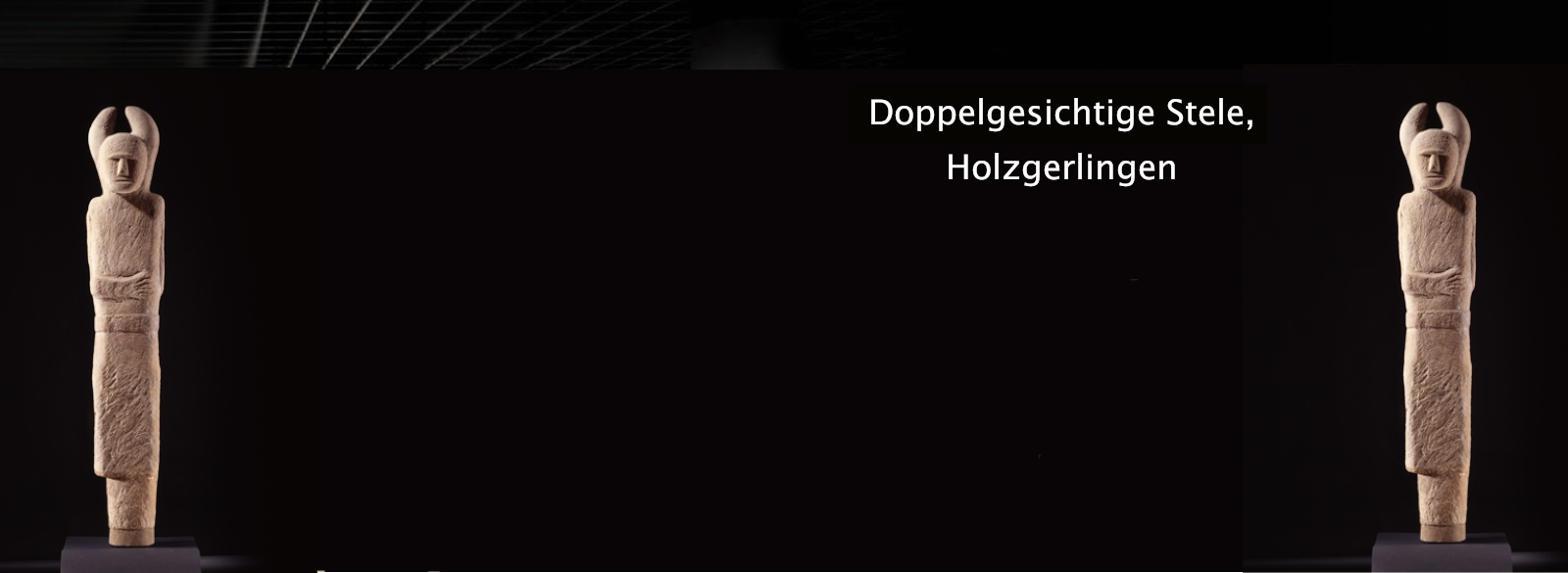

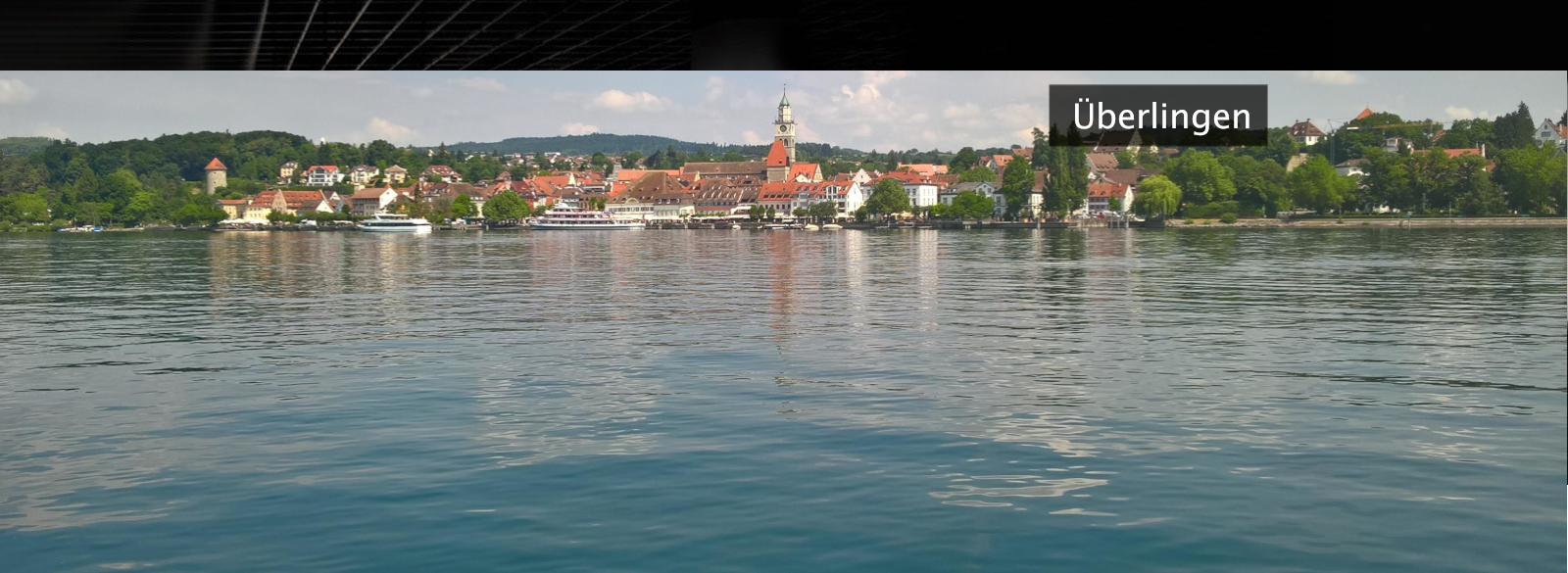

![[Provenienz]: Wolf, Erik](/media/ubf_digitalisate/current/delivered/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-15027/INTROIMAGE.jpg)
![[Provenienz]: Wolf, Erik](/media/ubf_digitalisate/current/generated/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-15027/INTROIMAGE.jpg.tm.png)

 leobw
leobw